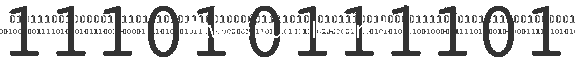
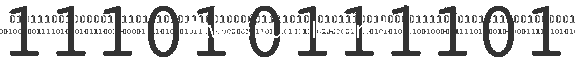
Frank Allmann / Simon Evereit
Das Streetfighter - Phänomen
Das Konzept des Streetfighters gibt es, seitdem es Motorräder gibt. Obwohl der Fighter erst in den letzten Jahren als Ausdruck einer speziellen Form des Customizing perfektioniert wurde, sind direkt vom Fließband kommende Motorräder von einer Minderheit der Fahrer schon immer nur als Rohmaterial angesehen worden. Diese Modelle sind nur Ausgangspunkte für die Kreation einer völlig einzigartigen und zumeist auch kräftigeren Maschine, als sie irgendjemand in seinem Schaufenster oder Laden anbieten kann. Der unwiderstehliche Drang zur Individualisierung von Motorrädern ist nichts Neues, und er hat sich über die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts in drei Hauptrichtungen manifestiert: dem Cafe- Racer, dem Chopper und dem Streetfighter. Schon vor dieser Zeit war es nicht unüblich, dass der Motorrad Enthusiast mit seiner Maschine zu einer Veranstaltung fuhr, dort die Beleuchtung und das Kennzeichen abmontierte und nach dem Anbau von Startnummern gegen Gleichgesinnte Rennen fuhr. Am Ende des Tages machte er sich mit der gleichen Maschine wieder auf den Heimweg, die er noch kurz zuvor gnadenlos um den Rennkurs gejagt hatte. Dies trat nicht nur auf Straßenrennen zu. Es war eine Zeit, als Motorräder noch nicht so stark auf besondere Aufgaben spezialisiert waren, eine Zeit, als nahezu jede Maschine sowohl bei Straßenrennen, als auch bei Sprints oder Geländefahrten eingesetzt werden konnten. Und sie wurden...... Zu Hunderten und Tausenden. Die Fünfziger und Sechziger sahen die Geburt des von der Rennstrecke beeinflussten Cafe- Racers, einer von der zeitgenössischen Jugend hervorgebrachten Maschine, mit der man auf der Straße die Helden der Rennstrecken imitieren konnte. Weil diese Motorräder von ihren Besitzern dazu benutzt wurden, sich schnellstmöglich von einem Treffpunkt- Cafe zum nächsten zu bewegen, hatten sie ihren Namen bald weg. Die Regeln waren einfach: Um die ganz wichtige rennmäßige Sitzhaltung zu gewährleisten, wurde ein Serienmotorrad bis auf den Rahmen entkleidet und mit einem großen Alutank, einem passenden Sitz, einem aus nach hinten gezogenen Krümmer und Megaphon oder kurzem Konus- Topf bestehenden Auspuff, Aluminium- Felgen und -Schutzblechen, Stummellenkern sowie zurückverlegten Fußrasten bestückt.
Obwohl nahezu alle Motorradmarken einer Cafe-Racer-Behandlung unterzogen werden konnten, waren doch die 500er und 650er Twins von Triumph, BSA und Norton die bevorzugten Maschinen, schließlich hatten diese Marken aufgrund ihrer echten Rennmaschine die größte Glaubwürdigkeit. Namen wie BSA Gold Star, Norton Manx, Velocette Thruxton zergingen auf der Zunge. Die Krönung war die in einem Norton-Federbettrahmen verpflanzte Antriebseinheit der Triumph Bonneville, woraufhin das Gerät den Namen TRITON tragen durfte. Ironischerweise war der von Rex McCandless erfundene Doppelschleifenrahmen in den vierziger Jahren für einen Triumph-Motor konzipiert worden, doch weil Norton-Fahrer Artie Bell sehr gute Erfahrungen mit diesem Fahrwerk gemacht hatte (Fährt sich wie ein Federbrett), bestellte seine Firma nach dem Krieg McCandless in die Rennabteilung. Mit diesem Rahmen konnte ab 1950 fast jeder Manx-Fahrer wesentlich stärkere Maschinen hinter sich lassen. Doch erst als auch die 600er und 650er Dominator-Serienmaschinen mit den Federbetten ausgerüstet wurden, waren diese Fahrwerke auch für die Jugend erschwinglich.
Als die sechziger Jahre zu Ende gingen und sich immer mehr Autobahn-Schneisen durch das Land zogen, verschwanden langsam die LKW-Cafes, die lange Zeit traditioneller Motorradtreffpunkte waren, von den Landstraßen. Dies fiel zusammen mit der Ankunft der schnellen und zuverlässigen Motorräder aus dem Land der aufgehenden Sonne. Der erste Hammer war die vierzylindrige Honda CB 750, darauf folgten in kurzen Abständen die Kawasaki Z 900 (Frankensteins Tochter), Suzukis GS 750 und 1000, Hondas Reihensechszylinder CBX 1000 und Yamahas überschwere XS 1000, um nur Beispiele zu nennen. Getunte englische Motoren konnten sich beispielsweise Tom Christensons von einem Norton Commando-Motor angetriebenen Dragster sehr lange bei amerikanischen Viertelmeilen-Rennen behaupten.
Die japanischen Vierzylinder ermöglichten es den Speed-Freaks auf der ganzen Welt, sich der Leistung zu bemächtigen, die vorher nur Werksteams und sehr reichen Leuten vorbehalten war. Mit dem Erscheinen einer Honda CB 750 oder Kawasaki Z 900 konnte nahezu jeder sein Erspartes auf den Tresen eines Händlers legen und mit einem Motorrad vom Hof fahren, das leistungsmäßig fast keine Wünsche offen ließ. Doch wieder gab es einen Zubehörmarkt und Leistungs-Gurus wie Colin Seeley, Paul Dunstall, Dave Degens (Dresda) und die Rickman-Brüder in England oder Eckert, Gläser und Rau in Deutschland und natürlich Fritz Egli aus der Schweiz. Sie alle stellten Leistungs- und Zubehörteile für individuelle Eigenbauten sowie verbesserte Fahrwerke gegen die damals typischen Händlingsschwächen her.
Auf der Viertelmeile kamen die japanischen Reihen-Vierer auch als erstes groß heraus - bei 400 Metern geradeaus machte sich ein schlechtes Fahrwerk nicht so sonderlich bemerkbar. Bereits 1975 brach Russ Collins mit seinem von drei Honda-Motoren und Lachgaseinspritzung angetriebenen Dragster die magische Acht-Sekunden-Grenze.
Auf der Rennstrecke sah es mit den japanischen Leitungswundern dagegen ganz anders aus. Schließlich hatte bereits mehr als zwanzig Jahre zuvor Norton mit der Federbett-Manx bewiesen, dass viele Pferdestärken nichts nützen, wenn man sie schlecht auf den Asphalt bringen kann. Und die japanischen Fahrwerke waren nicht nur weich, sondern auch schwer. Spezialisten wie Dunstall, Dresda und Read Titan boten zunächst Gabelstabilisatoren, Gussräder mit Qualitätsreifen, härtere Stoßdämpfer und stabilere Schwingen an. Und es dauerte nicht lange, bis Rickman und Seeley neben traditionellen Sportteilen wie großen Tank, kleinen Spitzen, lauten Auspuffanlagen und Stummellenkern auch komplette Rahmenkits anboten.
Zu dieser Zeit kam erstmals der Begriff "Superbike" auf. Die Superbike-Rennen kamen aus den USA, wo Serienmaschinen-Rennen wesentlich mehr beachtet wurden als die von den Europäern favorisierten WM-Grand-Prix-Rennen. Obwohl Steve McLoughlin das erste in Daytona abgehaltene Rennen auf einer BMW R 90S gewann, waren es anschließend lange Zeit die großen und brutalen Vierzylinder der vier japanischen Hersteller, mit denen die Pokale abgeräumt wurden. Und es gab berühmte Werks-Maschinen - zweirädrige Raufbolde wie Eddie Lawsons grüne Kawasaki Z 1000 oder Freddie Spencers Honda CB 900.
In den siebziger Jahren kamen erstmals amerikanische Teams nach Europa, zwar fuhren Kenny Roberts und Barry Sheene Zweitakt-GP-Maschinen, doch Wes Cooley hatte bereits eine Suzuki GS 1000 dabei. Und so dauerte es nicht lange, bis die ersten Hobby-Schrauber ihre Superbike-Imitate auf die Straße brachten. Kawasaki reagierte als erstes und brachte die Serien-Replika von Lawsons Z 1000 heraus - natürlich grün.
Erstaunlicherweise begann zeitgleich mit dem immer stärkeren Multizylinder-Motoren der Japaner die Ausbreitung des coolen Images der "gechoppten" Motorräder samt dem dazugehörigen Lebensstil. Nachdem der Low-Budget-Film "Easy Rider" auf beiden Seiten des Atlantiks in kürzester Zeit Kultstatus erreicht hatte, begann nahezu jeder Biker mit einem Hang zum Individualistischen von den umgebauten Panhead-Harleys von Peter Fonda und Dennis Hopper zu träumen. Wahrscheinlich rettete dieser Boom die kränkende Firma aus Milwaukee, doch auch die Japaner boten bald - zunächst in der Low-Budget-Klasse und später als freche Kopierer des amerikanischen Originals Werks-Custombikes an. Der Begriff "Custom" bedeutete eigentlich "individuell hergerichtet", doch die meisten Kunden begnügten sich damit, ihr Custombike mit Teilen aus dem Zubehörmarkt zu verzieren.
Obwohl die Chopper (chopping = abhacken) wenig mit Hochleistungs-Motorrädern gemeinsam hatten, waren es Leute aus dieser Szene, die erstmals ein Motorrad bauten, das den Namen
"Streetfighter" erhielt. Tiefergelegt und ausgerüstet mit einem großvolumigen und bis zum Anschlag getunten Vier- oder Sechszylindermotor sowie allen überflüssigen Zierrats (inklusive der Hinterradfederung) beraubt, sahen die Maschinen mehr nach Dragster als nach Easy-Rider-Chopper aus. Die Besitzer steckten ihr Geld lieber in die Erhöhung der Motorleistung als in Chrom- und Lackteile. Die Maschinen wurden zu einem einzigen Zweck gebaut: Sehr sehr schnell auf einer Geraden zum Ziel gelangen..... normalerweise zum nächsten Cafe.
Als Suzuki 1985 seine ölgekühlte GSX-R 750 mit Alu-Fahrwerk herausbrachte, wurde damit jedem gewöhnlichen Biker der Zugang zu einer echten Rennstrecken-Replika ermöglicht. Die originale GSX-R 750 basierte auf dem Langstreckenrenner XR 69, den Suzuki nicht öffentlich anbot. Die Leistungswerte von erschwinglichen Motorrädern waren damit endgültig durch die 100 PS-Schallmauer gebrochen. Doch ausnutzen konnte diese Leistung nur noch derjenige, der seine Maschine bei Spezialisten fahrwerksmäßig verbessern ließ.
Aus ästhetischer Sicht müssen perfekte Streetfighter-Rahmen sicherlich aus makellos verarbeiteten Alu- oder Stahlrohren gefertigt werden, wie sie Spondon oder Harris in Gitterrohr-Bauweise anbieten. Zwar haben die japanischen Hersteller im Fahrwerksbereich seit den siebziger Jahren viel gelernt, doch schöner sind ihre Rahmen dadurch nicht unbedingt geworden. Die Grenzen moderner Sportmaschinen liegen immerhin zumeist jenseits der Möglichkeiten der meisten Besitzer.
Nicht nur das Handling einer Kawasaki Z oder Suzuki GSX-R aus den achtziger Jahren kann durch den Einbau einer moderneren Upside-Down-Gabel, einer Einarmschwinge und modernen Dreispeichenräder mit schwimmenden Bremsscheiben und Mehrkolbensätteln verbessert werden, auch die Optik gewinnt merklich. Allerdings ist es auch eine Tatsache, das beim Thema Leistungsgewicht viele selbstgebaute Kreationen mit ihren modernen Fahrwerksteilen niemals mit der überragenden Grazie und dem Handling einer serienmäßigen Honda Fireblade, Yamaha R1 oder Kawasaki ZX 12 mithalten können. Was niemals geleugnet werden kann, ist die Tatsache, dass das Styling von der Straße stammt. Die selbstgebauten Cafe-Racer der fünfziger Jahre beeinflussten Serien-Sportmaschinen, wie etwa die BSA Rocket Gold Star und die Norton 650 SS der sechziger Jahre. Auf ähnliche Weise sprangen die Japaner Ende der siebziger Jahre auf den Chopper-Zug auf, um einen Teil des Custom-Kuchens abzukriegen. Sie schufen eine Reihe enttäuschender und absolut hässlicher Chopper-Imitate. Doch in den späten Achtzigern haben fast alle Söhne Nippons rechtzeitig erkannt, dass großvolumige nackte Retro-Bikes mit reichlich Drehmoment sehr populär waren, und so stellte man diese Sorte lammfrommer und furchtsamer Motorräder her, nach denen sich das Publikum so lange gesehnt hat. In den jüngeren Jahren haben Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha bis hin zu Ducati, Cagiva und auch Triumph erkannt, dass abgespeckte Streetfighter der letzte Schrei sind - folglich bot man mehr oder weniger verwässerte Imitationen an - genau wie damals bei den Choppern.
Wie sieht die Zukunft des Streetfighters aus? Die ursprüngliche Lehre, den Standart-Motor stärker, das Fahrwerk stabiler, die Reifen breiter und alles leichter zu machen, ist ausgereizt. Der einzige Weg, die modernen Serienmaschinen deutlich zu verbessern liegt darin, sie mit Komponenten auszurüsten, die sich auch an WM-Superbikes oder GP-Rennern gut machen. Je weiter das neue Jahrtausend fortschreitet, desto mehr ähneln die Werks-Streetfighter den Straßen-Maschinen, die sie nachahmen sollten.
Kawasakis Eddie Lawson-Replika ZX 12 hat inzwischen einen 190 PS-Motor und ersetzt die untermotorisierte ZXR 1100, Honda hat seine (übergewichtige) X 11, Cagiva baut mit den Restbeständen von Suzukis TL 1000-Motoren die Raptor-Modelle, Ducati stellt mit dem wassergekühlten 916-Aggregat die neue Über-Monster her, bei der Triumph Speed Tripple bekommt man statt der Streetfighter-Doppellampe einen "normalen" Scheinwerfer nur gegen Aufpreis, Yamaha toppt seien XJR 1300 mit der 1000er Fazer und Voxan schreibt sogar "Cafe Racer" an seine Maschinen.
Da Motoren heute für jeden Belang ausreichend stark sind (obwohl es weiter heißen wird: "Zuviel ist nie genug") und die Fahrwerke damit auch zurecht kommen, bleibt nur eine Verbesserung des Stylings. Ob es eine Rückkehr zur gestrippten Renn-Replika wird - als Zeuge tritt die füllige GSX-R 1000 der früheren neunziger Jahre auf, oder ob sorgfältiges Styling in Mode kommt (wie in Frankreich) - es scheint, dass die Tage der Rahmen-Kits gezählt sind. Die Anforderungen an Rahmenspezialisten, das Handling zu verbessern, werden immer komplizierter, seit die Hersteller ihre Konstruktionen und Herstellungsprozesse so weit verbessert haben, dass auch ein Serienfahrwerk die Räder eines aufgebohrten und mit Nitro-Booster versehenen Fighters in der Spur halten kann. Es scheint berechtigt zu erwähnen, dass sich seit den Tagen der Cafe-Racer in den fünfziger Jahren bis zu den Streetfightern, die heute von einer neuen Generation von Freaks gefahren werden, viele Dinge im Kreis gedreht haben. Die Parallelen zwischen beiden Konzepten sind offensichtlich. Beide wurden aus den schnellsten Maschinen ihrer Zeit gebaut, und beide waren und sind schneller, böser, klarer und unverschämter als alles, was ein Motorrad aus der Kiste jemals bieten kann. Doch vor allem sind sowohl Cafe-Racer als auch Streetfighter europäische Konzepte, und nicht wie die Chopper und ihre Ableger aus Amerika importiert. Somit sind sie der transatlantischen Ideologie "Zuerst die Form, dann die Funktion", wie sie in den Siebzigern auf die Chopper und ihre Nachkommen Einfluss hatte, nichts schuldig,
Streetfighter haben hingegen auf der ganzen Welt ihre Jünger bekehrt. Die Amerikaner favorisieren aufgrund der populären Dragsterrennen (wie immer) maximale Leistung, gefräste Räder und verlängerte Schwingen, besonders in den Südstaaten. In Deutschland sind bunt lackierte Motoren und äußerst kurze hochgezogene Hecks in Mode, Franzosen legen großen Wert auf perfekte Lackierung und schickes Styling, während Briten ihre zumeist nackten flachen Maschinen mit Insektenaugen lieben.
Mode und technischer Fortschritt bestimmen, wie und wann solche Trends sich verstärken, und welche Richtung sie nehmen werden. Doch eins ist ganz sicher: Solange es Motorräder gibt (wer weiß, was dem Gesetzgeber noch so einfällt), wird es immer fantasiereiche Leute geben, die alles noch etwas unverschämter, frecher und extremer machen müssen.
Willkommen in der Welt der Streetfighter.